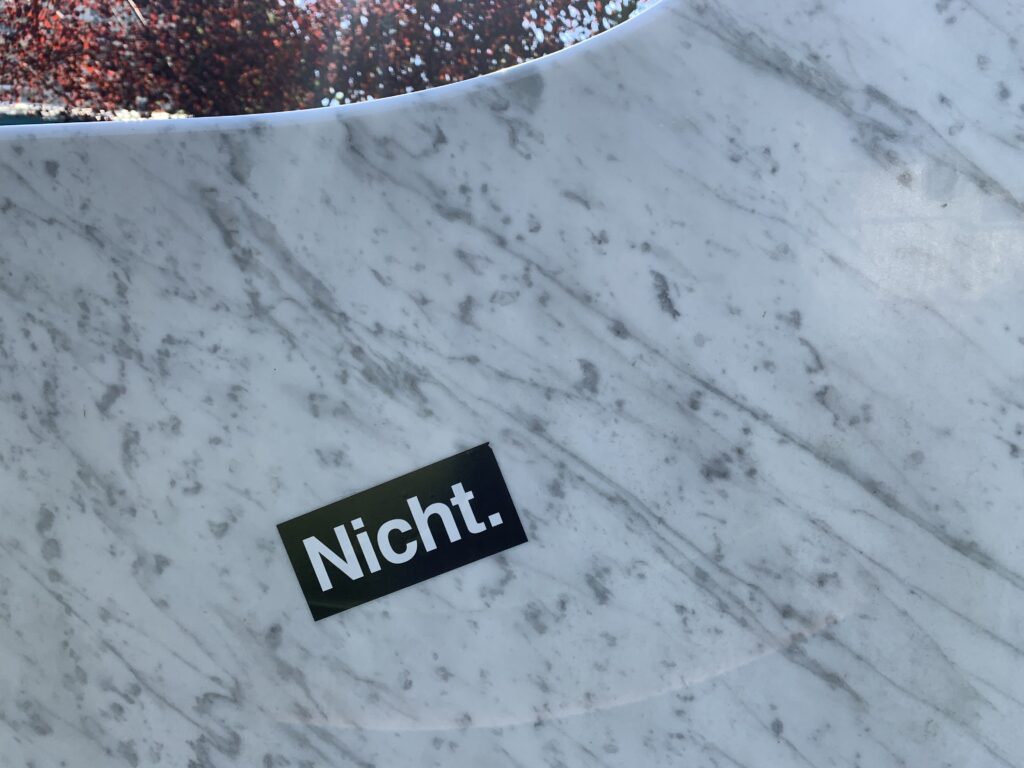Der ehemalige Bundesrat Flavio Cotti ist mit 81 Jahren offenbar an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Er gehört mit Ruth Dreifuss zu den Architekten der Krankenversicherung.
Der ehemalige Bundesrat Flavio Cotti ist mit 81 Jahren offenbar an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Er gehört mit Ruth Dreifuss zu den Architekten der Krankenversicherung.
Damals, 1990, als er amtierender Bundesrat war, schätzte er es, auch gern mal mit Journalisten im kleinen Kreis ein Gespräch zu führen. Wir waren zu zweit eingeladen in seine Stammbeiz, ins Della Casa. In Bern. Kurz vor dem Essen kam noch schnell sein Pressesprecher bei uns im Büro vorbei und teilte uns mit, dass es nur ein kurzes Treffen geben werde, der Chef habe um halb zwei eine Sitzung.
Es war vor Weihnachten, das Wetter trüb. Bis um halb zwei redeten wir gestelzt über ganz wichtige Sachen. Bei jedem Wort kamen wir uns sehr wichtig vor, denn wir unterhielten uns ja mit einem Bundesrat. Dann tauchte der Pressesprecher wieder auf im ersten Stock des Della Casa und sagte, es sei Zeit für die Sitzung. Der Bundesrat überhörte es einfach und schickte den Pressesprecher weg. Wir sprachen weiter, schwatzten drauflos, weil ja halb zwei vorbei war, und der Bundesrat jederzeit aufstehen und zur Sitzung eilen würde und es gar nicht so eine Rolle spielte, was man da noch sagte. Dann kam der Pressesprecher wieder und sagte mit betretener Stimme, der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt sei gestorben. Der Bundesrat, der mit uns am Tisch sass, dachte nach und gab ein Beileidsschreiben im Namen der Landesregierung in Auftrag. Es herrschte betretenes Schweigen.
Der Bundesrat versuchte es zu brechen, mit einer Runde Grappa. Er fragte nach dem persönlichen Ergehen von uns beiden. Mein Kollege berichtete, dass er neuerdings Teilzeit arbeite wegen seiner Kinder. Da sagte der Bundesrat, er beneide ihn und erzählte, wie er mit seiner Tochter eine heftige Auseinandersetzung geführt habe, wegen einer Nichtigkeit. Das ganze Wochenende sei trostlos gewesen. Und dies nur, weil er nichts als Ruhe gewünscht habe. Und während er sprach, wurde seine Stimme dünner, brüchiger, und schliesslich weinte er. Wir wussten nicht so genau, wo wir hinschauen sollten. Einfach nicht zum weinenden Bundesrat, der wenige Tage zuvor strahlend hinter einem Blumenstrauss gestanden hatte, als er zum Bundespräsidenten fürs folgende Jahr, fürs 1991, gewählt wurde.
Nun erschien der Pressesprecher zum dritten Mal. Er sagte, die Kommission habe die Sitzung unterbrochen. Bis zum Erscheinen des Bundesrats. Der Bundesrat fragte, ob wir noch eine Runde Grappa möchten. Wir sagten ja. Als wir leer getrunken hatten, standen wir auf, begaben uns ins Erdgeschoss, dann hinaus auf die Strasse. Der Bundesrat verabschiedete sich, Windböen zerzausten seine schütteren Haare, die er sich irgendwann über den schon recht kahlen Schädel gekämmt hatte.